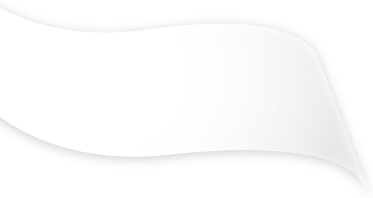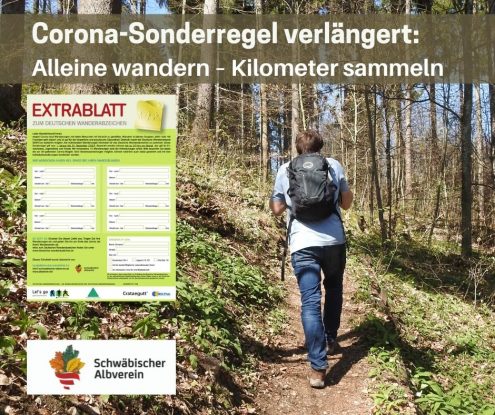Seit 30 Jahren kümmert sich der Stromberggau um das Naturschutzgebiet Füllmenbacher Hofberg in der Gemeinde Sternenfels. Nachdem im September bereist gut 30 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Einsatz waren, steht am Samstag, 9. Oktober, ein weitere Naturschutzeinsatz an.

„Durch den vielen Regen dieses Jahr sind die Wiesen und Büsche stark gewachsen“, berichtet Gaunaturschutzwart Ulrich Gommel. Er gab deshalb viel Mähmasse – Gras, Dornengestrüpp und anderes Gesträuch. Der hauptamtliche Landschaftspflegetrupp des Albvereins war für das Mähen und Ausschneiden zuständig. Die Aufgabe der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer besteht darin, das Mähgut zusammenzurechen. Dann wird es auf Planen verfrachtet und an das Fußende des Bergsporns herabgezogen. Dort lädt es ein Landwirt auf und fährt es weg.
Gemeinsam macht auch schweißtreibende Arbeit Spaß.
Die Arbeiten sind schweißtreibend, da der Hofberg in Teilen ein hohes Gefälle aufweist. Gommel freut sich deshalb um jede helfende Hand. „Gerne können noch Freiwillige am Samstag dazukommen“, betont er. Arbeitsmaterial wie Rechen und Arbeitshandschuhe gäbe es genug. Außerdem stehe für jeden Helfer, jede Helferin ein herzhaftes Vesper im Jugendwanderheim Füllmenbacher Hof bereit.
Schülerinnen und Schüler kommen zum Helfen.
Auch Schülerinnen und Schüler der 6. Jahrgangsstufe der Freien Schule Diefenbach waren in diesem Jahr wieder beim Naturschutzeinsatz mit dabei sind. Sie verbanden ihren Naturschutzeinsatz mit einer gemeinsamen Wanderung zum Naturschutzgebiet.
Früher Weinberge, heute wertvoller Magerrasen
Noch Anfang der 1990er Jahre bestand der Füllmenbacher Hofberg aus vielen kleinen Weinbergen, von denen die meisten nach und nach aufgegeben wurden. Der Berghang drohte zu verbuschen. Der Schwäbische Albverein hat sich lange für eine Ausweisung des Areals als Naturschutzgebiet eingesetzt. Der Durchbruch kam, als das Land Baden-Württemberg einen großen Teil der brach liegenden Grundstücke aufkaufen. 1995 schließlich wurde der Füllmenbacher Hofberg zum Naturschutzgebiet.
Die insgesamt 3,4 Hektar bestehen vorrangig aus Magerrasen mit einer vielfältigen Vegetation. Unter anderem wachsen dort seltene Orchideen. Um das Gelände offen zu halten, muss dort einmal im Jahr gründlich gemäht werden. Und, das ist Gaunaturschutzwart Gommel ganz wichtig, abgeräumt werden. Denn nur so könne eine Überdüngung vermieden und der Charakter des Naturschutzgebiets erhalten werden.
Besucherandrang während der Corona-Zeit
Während der Corona-Zeit erfreute sich der Füllmenbacher Hofberg zunehmender Beliebtheit bei Ausflüglern. „Das war zum Teil ein Riesenandrang“, berichtet Ulrich Gommel. Die Leute seien zum Teil kreuz und quer über die Wiesen gelaufen oder sind mit ihren Bikes den Hang heruntergefahren. „Das hat dem sensiblen Gelände nicht gut getan.“ Mittlerweile habe sich die Situation allerdings entspannt. Das Regierungspräsidium habe schnell reagiert, Schranken aufgestellt und mit Beschilderung auf die Regeln im Naturschutzgebiet hingewiesen.
Dank an die Umweltstiftung Stuttgarter Hofbräu AG für die Unterstützung
Für seinen Einsatz um das Naturschutzgebiet wurde der Stromberggau schon mehrfach ausgezeichnet. Der Schwäbische Heimatbund verlieh dem Verein 2002 den Landschaftskulturpreis und auch von EDEKA-Südwest gab es eine finanzielle Förderung. Derzeit erhält der Verband für die Pflege des Gebiets finanzielle Unterstützung von der Umweltstiftung der Stuttgarter Hofbräu AG.
Wenn Sie mithelfen wollen, dann melden Sie sich doch bitte kurz bei Gaunaturschutzwart Ulrich Gommel an unter Telefon 07041/ 864615 oder per E-Mail an . Das erleichtert uns die Planung.