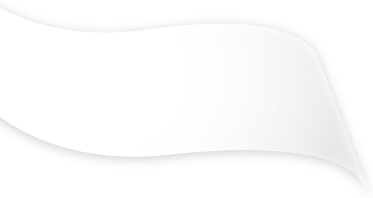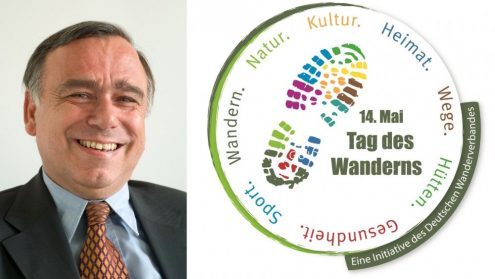Alle Welt zieht es in die Natur. Wohin auch sonst? Wegen Corona sind viele Freizeitaktivitäten ja gerade nicht möglich. Der Schwäbische Albverein sieht den Trend zum Wandern und Naturerleben grundsätzlich sehr positiv. Aber er hat auch seine Schattenseiten, berichtet Sylvia Metz, Mitglied im Arbeitskreis Naturschutz des Schwäbischen Albvereins und Mitarbeiterin im Referat Natur- und Landschaftspflege beim Regierungspräsidium Tübingen im Interview.
Viele Leute zieht es während der Corona-Pandemie in die Natur. Wie finden Sie das?
Ich finde das gut. Es ist schön, wenn die Menschen die Natur entdecken und kennenlernen. Gut für die Gesundheit ist es außerdem. Die Kehrseite ist halt, dass es zunehmend zu Nutzungskonflikten kommt. Gerade in Naturschutzgebieten, die den Zweck haben vorrangig Pflanzen und Tiere zu schützen.
Wie sehen die Probleme konkret aus?
Ich spreche jetzt ausdrücklich über Naturschutzgebiete. In fast allen herrscht ein Wegegebot. D.h. die Menschen sollen auf den Wegen bleiben und nicht abseits davon unterwegs sein. Damit möchte man der empfindlichen Tier- und Pflanzenwelt Ruhe gönnen. Während der Brut- und Aufzuchtzeit sind viele Vögel sehr empfindlich, was Störungen durch Wanderer, Radfahrer und vor allem auch durch Hunde angeht. Dann verlassen sie ihre Nester, die Eier kühlen aus oder die Jungvögel werden verlassen. Die Heidelerche ist so ein sensibles Tier. Ein weiteres Beispiel sind die vielen kleinen Trampelpfade, die entstehen, wenn viele Leute abseits der Wege unterwegs sind, oder Wege verbreitern sich. Dann leidet die Vegetation in empfindlichen Ökosystemen. Dann gibt es auch die Fotografen, die für die Sozialen Medien gerne das perfekte Bild von den Blümchen machen möchten und rundherum alles platt treten.
Und dann natürlich der Müll, der überall herumliegt.
Noch schlimmer sind die Hinterlassenschaften aufgrund unseres natürlichen Bedürfnisses. Das ist ein Riesenproblem an manchen Orten. Dazu kommt das Lagern und Picknicken. Das ist meiner Beobachtung nach ein großer Trend, und zwar nicht nur, weil die Gastronomie wegen Corona geschlossen hat. Es ist ja auch schön, sich an einem idyllischen Fleckchen niederzulassen und zu vespern. Aber in den Naturschutzgebieten bitte nur auf den Bänken oder Rastplätzen. Und diese stehen ja oft an besonders schönen Stellen.
Haben sich Probleme durch Corona verschärf?
Ja, deutlich. Einfach durch die schiere Menge an Menschen, die in der Natur unterwegs ist. Meine Hoffnung ist, dass sich das wieder entspannt, wenn auch andere Freizeitaktivitäten wieder möglich sind. Mein Eindruck ist, dass unter den Ausflüglern viele Wander-Neulinge oder „Outdoor-Einsteiger“ sind. Ich bin überzeugt, die meisten wollen gar nicht unsensibel sein oder Schaden anrichten. Es fehlt oft an Wissen über das angemessene Verhalten in der Natur.
Verschärft der Trend zu touristischen Rundwanderwegen die Situation?
Das ist in der Tat so. Gerade jetzt, wo wegen Corona so viele Menschen die Premium- oder Qualitätswege nutzen, wird in vielen Gemeinden deutlich, dass es eigentlich eine begleitende Infrastruktur braucht. Die Menschen müssen halt irgendwo parken und zur Toilette geben. Aber da gibt es keine Patentlösung. Man muss vor Ort nach Lösungen suchen, die auch den Naturschutz berücksichtigen.
Man sieht immer wieder tiefe Furchen in den Wegen und im Waldboden bedingt durch forstwirtschaftliche Aktivitäten. Wie erklärt man den Menschen, dass der Harvester bzw. Holzvollernter durch den Wald fahren darf, man selber aber auf den Wegen bleiben soll?
Wenn wir uns draußen bewegen, befinden wir uns meist in einer bewirtschafteten Landschaft. Und zur Bewirtschaftung gehören bestimmte Dinge dazu. Im Wald ist das ein System von Rückegassen für den Forstbetrieb und seine Harvester. Andere Bereiche bleiben dafür außen vor. Im Unterschied zum Freizeitsportler, zum Wanderer und Mountainbiker, ist der Harvester nicht dauernd unterwegs. Er fährt einmal durch, dann ist viele Jahre wieder Ruhe. Die Fahrspuren dienen oft sogar der einen oder anderen geschützten Art als Lebensraum, wie etwa der Gelbbauchunke. Ähnlich könnte man auch bei Wiesen argumentieren. Warum darf der Landwirt die Orchideenwiese mähen, aber ich darf die geschützten Pflanzen nicht pflücken? Aber ohne die Mahd würde die Wiese verbuschen, die Pflanzen kommen mit den Mähterminen klar. Auch viele Naturschutzgebiete sind landwirtschaftlich genutzt. Besonders die herkömmliche, extensive Nutzung ist nötig zur Erhaltung ihrer Schutzwürdigkeit, etwa bei Magerwiesen oder Wacholderheiden. Diese Nutzung wird durch die Naturschutzgebiets-Verordnungen geregelt und oft durch Förderprogramme unterstützt. Unsere Landschaft ist kein Park für Freizeitgestaltung, das sollte man sich immer wieder mal vor Augen halten.
Pressemitteilung des Schwäbischen Albvereins vom 18. Mai 2021: Naturschutzgebiete unter Druck
In Stuttgart wird an einem Freizeitkonzept für den Wald gearbeitet, um verschiedene Nutzungsinteressen miteinander zu versöhnen. Was halten Sie aus Sicht des Naturschutzes davon?
Grundsätzlich denke ich, dass es wichtig ist, an konkreten Beispielen Interessen abzuwägen und Lösungen auszutüfteln. Wir leben nun mal in einer Landschaft, in der verschiedene Nutzungsinteressen aufeinandertreffen. Da müssen alle mit ins Boot. Im Sinne des Naturschutzes ist es wichtig, gerade die geschützten Tiere und Pflanzen noch stärker in den Blick zu nehmen. Mir geht es nicht um eine Fundamentalgegnerschaft, aber die schutzbedürftige Natur braucht eine starke Stimme, weil sie nicht selber sprechen kann.
Kann es eine Lösung sein, besonders sensible Gebiete ganz zu sperren?
Etwa wenn dort Arten leben, die es ansonsten in Baden-Württemberg nicht mehr gibt.
Das ist bei uns eher die Ausnahme, ist aber manchmal während der Vogelbrutzeit oder in winterlichen Ruhezeiten nötig. In Heidelerchen-Brutgebieten stellen wir beispielsweise Hinweistafeln auf. Im Bereich Tübingen hat das Landratsamt bestimmte Wege zur Brutsaison der Kiebitze gesperrt. Im Schwarzwald gibt es Ruhezonen für das Auerhuhn. Aber das braucht dann schon eine konkrete Begründung. Grundsätzlich haben wir natürlich auch das Problem, dass man so eine Sperrung auch überwachen müsste. Aber da fehlt oft das Personal. Umso wichtiger ist es, die Leute zu informieren und an die Eigenverantwortung zu appellieren.
Wie kann so eine Information aussehen?
Ganz wichtig ist die Arbeit der Verbände und gesellschaftlichen Gruppen, wie des Schwäbischen Albvereins oder anderer Naturschutzverbände, die aufklären und deren Ehrenamtliche aktiv im Naturschutzdienst, etwa. als Naturschutzwarte, mitarbeiten. Auch dass Gemeinden zunehmend an Hotspots aktiv werden, ist wichtig. Ein Beispiel ist der Uracher Wasserfall, wo derzeit neue Schilder den Weg weisen. Durch die vielen Pfade war einfach nicht mehr klar, wo der Weg verläuft. Die Naturschutzzentren sind ganz wichtig, mit ihren Führungen und Ausstellungen. Gerne würden wir auch das Rangersystem ausweiten. Ranger gibt es im Donautal, im Biosphärengebiet Schwäbische Alb oder im Schwarzwald. Diese können die Leute direkt ansprechen und sie informieren. Regeln und Verbote sind nötig, aber sie sollen verständlich und nachvollziehbar sein. Wir wollen gern an die Einsicht und die Eigenverantwortung der Menschen appellieren und mit Information und Aufklärung dazu beitragen.
Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) bietet umfassende Informationen und Karten zu Schutzgebieten im Land unter https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/.